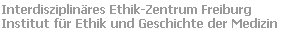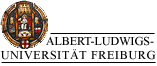Die vielfältigen medizin- und biotechnologischen Möglichkeiten, in den Menschen einzugreifen, ihn zu gestalten, sein „Natürlichsein“ verfügbar zu machen, rufen ein grundsätzliches Orientierungsbedürfnis hervor. So wird in der bioethischen Debatte immer wieder auf die „Natur des Menschen“ als eine Grenze möglicher Eingriffe verwiesen. Daher bearbeitet die Nachwuchsgruppe die Frage, ob überhaupt und, wenn ja, inwiefern die „Natur des Menschen“ tatsächlich als eine Norm bei biomedizinischen Grenzproblemen fungieren kann.
Die Nachwuchsgruppe ist auf acht Jahre angelegt (Oktober 2004-September 2012); davon werden fünf durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Förderschwerpunktes „Ethische, rechtliche und soziale Aspekte der modernen Lebenswissenschaften und der Biotechnologie“ (ELSA) gefördert (Förderkennzeichen 01 GP 0490).
» Homepage des BMBF
» Homepage ELSA
Das Projekt ist durch die Ausrichtung seiner Mitarbeiter sowie die Aufteilung der Bearbeitungsaufgaben interdisziplinär angelegt, hat sich in verschiedenen Projekten (siehe Projekte/Kooperationen) und Fakultäten (v. a. Philosophie, Theologie, Medizin, Biologie) interdisziplinär vernetzt. Gleich zu Beginn konnte mit dem Verbundprojekt zum Status des extrakorporalen Embryos (Leitung: Prof. Dr. Giovanni Maio) eine produktive Verzahnung hergestellt werden.
» Homepage des Verbundprojekts
Projektziele:
1. Erhebung der normativen Verwendungsweisen der „Natur des Menschen“ in den bioethischen Fachdebatten: Ziel ist eine Differenzierung der Argumentationsweisen mit Rückgriff auf die „Natur des Menschen“ auf der einen und eine Systematisierung der Verwendungskontexte auf der anderen Seite (die in der Gentechnik-Debatte zu findenden anthropologische Argumente unterscheiden sich z.B. von denjenigen in der Neuroethik).
2. Herausarbeitung der in der Bioethik verwendeten unterschiedlichen anthropologischen Konzepte und der damit verknüpften Vorannahmen: Da auf die „Natur des Menschen“ auf sehr verschiedene Weise rekurriert werden kann, müssen anthropologischen Argumente und ihre normativen Absichten systematisiert werden. Eine zentrale Rolle spielen dabei die unausgesprochenen anthropologischen Hintergrundannahmen bioethischer Theorien.
3. Ermittlung von Reichweite und Grenzen eines normativen Rekurses auf die „Natur des Menschen“: Ein wesentliches Ziel des Projektes ist es, die Normbildungen zu diskutieren, die auf anthropologischer Basis möglich sein können. Dafür werden die einschlägigen Theorien der philosophischen und theologischen Tradition produktiv und kritisch herangezogen (Verhältnis von Norm- und Wertbildung, Grenzen des naturalistischen Fehlschlusses, Möglichkeiten und Grenzen klassischer anthropologisch fundierter Moraltheorien).
4. Anwendung der erarbeiteten ethisch-anthropologischen Theorien auf aktuelle bioethische Streitfragen: Da der Prüfstein der theoretischen Überlegungen das konkrete Problem ist, werden Reichweite und Grenzen anthropologisch fundierter ethischer Theorien – mit besonderem Blick auf das ärztliche Ethos und das menschliche Selbstverständnis im Zeitalter der technologischen Zivilisation – anhand verschiedener biomedizinischer Anwendungsfelder untersucht (siehe Anwendungsschwerpunkte).
Anwendungsschwerpunkte:
1. Ethische Implikationen der Technisierung des Menschen am Beispiel aktueller Neurotechnologien (Brain-Machine-Interfaces, Tiefe Hirnstimulation). Dies wird seit Mai 2009 in einem eigenen, an die Nachwuchsgruppe angeschlossenen Projekt bearbeitet: Siehe die Informationen zum Bernstein Focus: "Neuroethics and Neurotechnology: Emerging Questions from 'Hybrid brains'".
2. Ethische und anthropologische Aspekte der Optimierung des Menschen am Beispiel verschiedener pharmakologischer Enhancementtechniken.
3. Die reproduktionsmedizinischen Techniken (z.B. Schaffung von Fertilitätsreserven) betreffen die menschliche Lebensform fundamental und stellen die gängigen Vorstellungen von „Natürlichkeit“ in Frage; vor diesem Hintergrund werden die anthropologischen Implikationen dieser Techniken untersucht.
4. Da die synthetische Biologie hinsichtlich des menschlichen Selbstverständnisses eine Herausforderung darstellt, werden auch in diesem Kontext die anthropologischen Aspekte bearbeitet.
Stefan-Meier-Str. 26, D - 79104 Freiburg | Tel. +49(0)761/203-5033, Fax: +49(0)761/203-5039